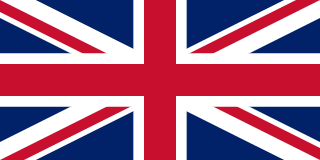Ressourcen
Wertvolle Ressourcen stehen für Dich bereit – inklusive NLP-Übungsgruppen, NLP-Bibliothek und NLP-Online-Community.
Lektionen
» Milton-Modell (21)
» Selbsthypnose (22)
» Metaphern (23)
» Lebensmetaphern (24)
Audio/Videobeiträge
» Milton-Modell Einführung
» Trance-Induktion 5-4-3-2-1
» Was ist Hypnose
» Metaphern
Textartikel
» Biographie Milton Erickson
» Geschichte der Hypnose
» Gebrauch von Metaphern
» Modell der Salutogenese
Erfolgskontrollen
» Testing 01
» Testing 02
» Testing 03
» Testing 04
Modell der Salutogenese
So wie wir über die Welt denken, wird sie sich uns offenbaren. Nehmen wir das Leben als Spiel, werden wir Herausforderungen gerne annehmen; betrachten wir unser Leben als Schicksal, werden wir danach handeln – oder eben nicht, denn Schicksal ist bekanntlich vorbestimmt.
Aaron Antonovsky (1923–1994), ein amerikanischer Medizinsoziologe, der 1960 nach Israel emigrierte, beschäftigte sich mit der Frage, warum einige Menschen trotz extremer Belastung nicht krank werden. Hierfür untersuchte er ehemalige Insassen von Konzentrationslagern im Zweiten Weltkrieg und entwickelte daraufhin das Modell der Salutogenese.
„Warum bleiben Menschen – trotz vieler potenziell gesundheitsgefährdender Einflüsse – gesund? Wie schaffen sie es, sich von Erkrankungen zu erholen? Was ist das Besondere an Menschen, die trotz extremster Belastungen nicht krank werden?“ Das sind die zentralen Fragen, die Antonovsky stellte.
Er entwickelte das Konzept der Salutogenese (von lateinisch salus: Heil, Glück; und griechisch genesis: Entstehung). Antonovsky sah darin einen Gegenpol zur Pathogenese, also zur Fokussierung auf die Entstehung und Behandlung von Krankheiten. Salutogenese bedeutet, den Menschen als gleichzeitig mehr oder weniger gesund und mehr oder weniger krank zu betrachten.
Für den Vergleich zwischen dem Denken der traditionellen Medizin und seinem Ansatz nutzte Antonovsky eine Metapher:
„Die pathogenetische Herangehensweise möchte Menschen mit hohem Aufwand aus einem reißenden Fluss retten, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie sie hineingeraten sind und warum sie nicht besser schwimmen können. Aus Sicht der Gesundheitserziehung hingegen springen Menschen nicht freiwillig in den Fluss und weigern sich gleichzeitig, das Schwimmen zu lernen.“
Und weiter schrieb Antonovsky:
„Meine fundamentale Annahme ist, dass der Fluss der Strom des Lebens ist. Niemand geht sicher am Ufer entlang. Ein Großteil des Flusses ist verschmutzt, und es gibt Strömungen, Stromschnellen und Strudel. Meine Arbeit widmet sich der Frage: Wie wird man – wo immer man sich im Fluss befindet – ein guter Schwimmer?“
Ob nun ein Mensch aus dem Fluss gezogen wird, der Fluss entschärft oder ihm das Schwimmen beigebracht wird, hängt von den individuellen Voraussetzungen ab. Die Fähigkeit „zu schwimmen“ bezeichnet Antonovsky als das Kohärenzgefühl – den sogenannten Sense of Coherence (SOC).
Die drei Komponenten des Kohärenzgefühls
Der Sense of Coherence beschreibt eine grundlegende Lebenseinstellung, die auf drei Komponenten beruht:
- Verstehbarkeit: In welchem Maß man interne und externe Ereignisse als geordnet, erklärbar und vorhersehbar wahrnimmt – statt als chaotisch und willkürlich.
- Handhabbarkeit: Die Überzeugung, dass einem ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen, um Herausforderungen zu bewältigen – entweder aus sich selbst heraus oder mit Hilfe anderer.
- Bedeutsamkeit: Die Einschätzung, dass die Aufgaben des Lebens es wert sind, gemeistert zu werden. Bedeutsamkeit liefert Motivation und gilt als wichtigste Komponente des SOC.
Wie entsteht ein starker SOC?
Der kulturelle, gesellschaftliche, familiäre und persönliche Hintergrund – ebenso wie der Zufall – schaffen sogenannte generalisierte Widerstandsressourcen: etwa materielle Sicherheit, Wissen, Intelligenz, Selbstbewusstsein, Bewältigungsstrategien, kulturelle Stabilität, Weltbild, Glauben, soziale Einbindung und einen gesunden Lebensstil. Aus ihnen entstehen Lebenserfahrungen, die durch Konsistenz, Mitgestaltung und Balance zwischen Über- und Unterforderung geprägt sind. Diese Erfahrungen sind entscheidend für die Stärke des Kohärenzgefühls.
Fehlen diese Ressourcen, spricht Antonovsky von generalisierten Widerstandsdefiziten. Sie beeinträchtigen sowohl die Lebenserfahrungen als auch die Entwicklung eines starken SOC.
Zusammenfassend gilt: Eine Haltung, die die Welt als verstehbar, handhabbar und bedeutsam betrachtet, liefert die kognitive und motivationale Basis, um Stressoren erfolgreich zu bewältigen. Menschen mit starkem SOC neigen weniger zu gesundheitsschädigendem Verhalten wie Rauchen oder übermäßigem Alkoholkonsum, da sie weniger unter Stress leiden und motivierter sind, für ihre Gesundheit zu sorgen.
Antonovsky betonte aber auch, dass Stress selbst einen direkten Einfluss auf den Organismus hat. Gehirn, Immunsystem und andere Körpersysteme sind eng miteinander verbunden. Intensive oder langanhaltende Stressoren können dieses Gleichgewicht stören und so die Gesundheit beeinträchtigen.